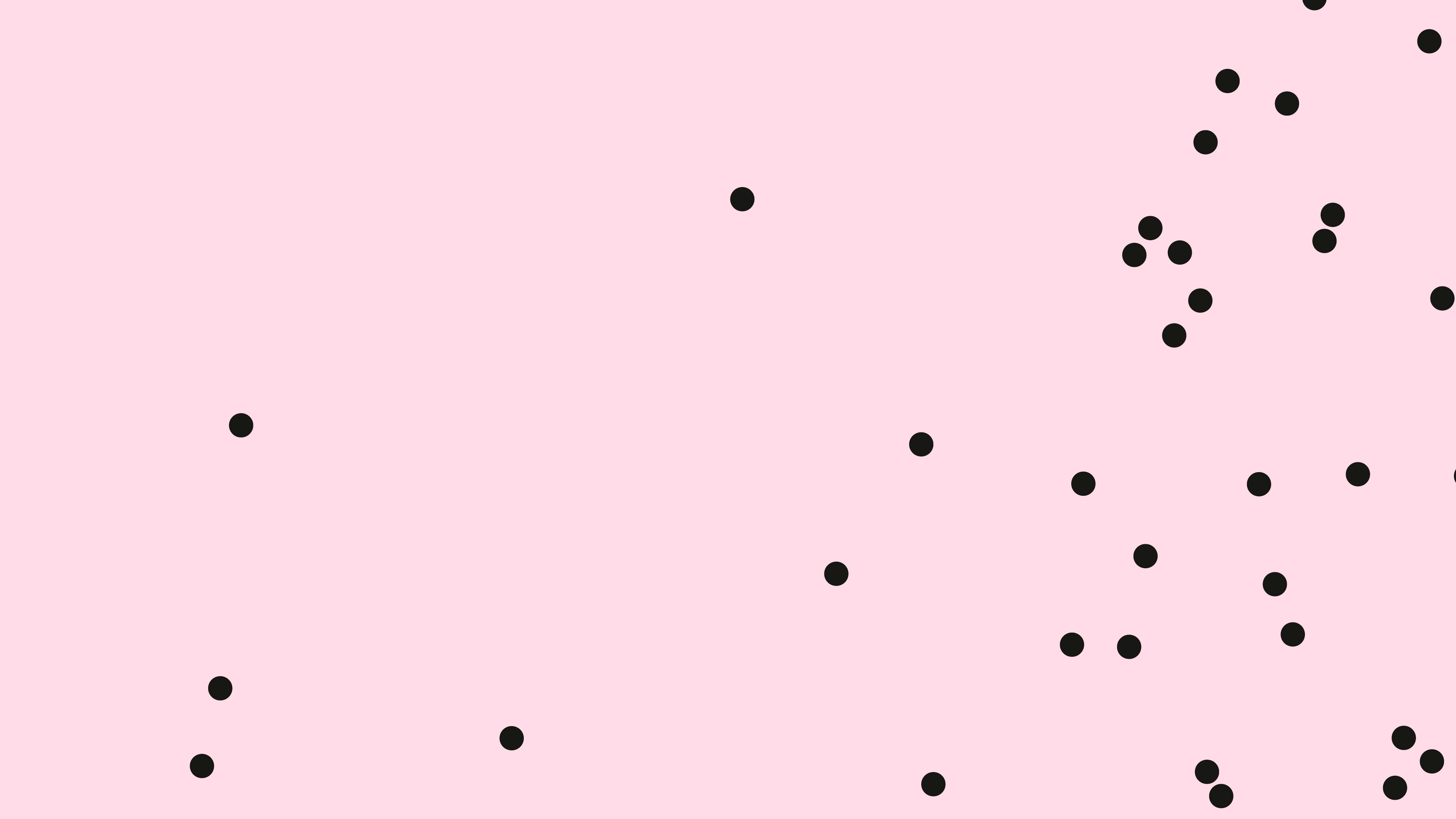- Intralogistik
- Interview
- Automatisierung
Robotics Piece Picking: Vom Hype zur Realität – und wie die nächste Evolutionsstufe aussehen könnte
Robotics-Experte Leif Jentoft darüber, warum Piece-Picking-Roboter zuverlässig greifen, aber noch nicht massenhaft eingesetzt werden.
In a nutshell: Robotics Piece Picking hat den großen Durchbruch verfehlt: Prognosen lagen Milliarden Dollar entfernt von der Realität. Die Technik kann picken, doch Integration und Planung bremsen. Jetzt entscheidet, ob Standard-Workflows und Foundation Models den Schritt vom Hype zu nachhaltigem Wachstum ermöglichen. Im Gespräch mit Leif Jentoft, Robotics-Experte, Co-Founder und früherer CSO von RightHand Robotics.
Ein Markt zwischen Versprechen und Ernüchterung
Robotics Piece Picking (RPP) – die robotergestützte Stückkommissionierung – galt lange als eine der Schlüsseltechnologien der Lagerautomatisierung. Analysten sahen darin den Hebel, um den boomenden E-Commerce zu bewältigen und den Arbeitskräftemangel in Lagern zu entschärfen. Schon Grand View Research (2019, Warehouse Order Picking Market Report) prognostizierte, dass der Markt bis 2025 ein Volumen von über 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Andere Studien, etwa Markets & Markets (2020), erwarteten sogar fast 3 Milliarden bis 2026.
Die Logik schien plausibel: Wer Roboter so intelligent und zuverlässig macht, dass sie Produkte wie Menschen kommissionieren können, würde einen Milliardenmarkt dominieren.
Doch heute, 2025, zeigt sich ein anderes Bild. Laut Interact Analysis (2024, Warehouse Automation & Robotics Report) lag das globale Marktvolumen 2023 bei nur 303 Millionen US-Dollar – ein Bruchteil dessen, was Prognosen für diesen Zeitpunkt vorausgesagt hatten. Statt einer explosionsartigen Entwicklung sehen wir ein vorsichtiges, schrittweises Wachstum.
Warum die Realität langsamer kam als der Hype
Die Technik hat große Fortschritte gemacht. Moderne Systeme schaffen mehrere Hundert Picks pro Stunde und erreichen Genauigkeiten von über 99 Prozent. Dennoch blieb die Breite aus. Denn Picking ist kein isolierter Vorgang, sondern eingebettet in komplexe Lagerprozesse.
„Das Picking-Problem ist weitgehend gelöst. Aber die besten Roboter können noch nicht alles, was ein Mensch kann. Auch das Platzieren funktioniert. Doch was ist mit den Ausnahmen?“, fragt Jentoft.
Menschen übernehmen die Ausnahmebehandlung und zusätzliche Aufgaben ganz selbstverständlich. Roboter hingegen benötigen zusätzliche Systemunterstützung, um gut zu arbeiten – zum Beispiel Workflows für Ausnahmebehandlung in der Lagerverwaltungssoftware, roboterfreundliche Arbeitsplätze im Pickbereich, Automatisierungskomponenten oder umfangreiche Anpassungen. Das macht die Integration komplexer und treibt die Kosten in die Höhe.
Auch das Versprechen einfacher Umbauten von Ware-zur-Person-Arbeitsplätzen entpuppte sich als Illusion. Jedes Lager ist anders: Grundrisse, Behältersysteme, IT-Schnittstellen, Sicherheitsvorgaben. „Sales glaubt oft, ein Retrofit sei einfacher, als es in Wirklichkeit ist. In Wahrheit stößt man in jedem Lager auf völlig unterschiedliche Parameter“, sagt Jentoft.
Und dann sind da die Integratoren. RPP-Unternehmen liefern wertvolle Technologie, „bieten aber oft nicht genug zusätzlichen Projektumfang, um ein gesamtes Projekt allein tragen zu können“, erklärt Jentoft. Große Systemhäuser wie Dematic, KNAPP oder SSI Schäfer verdienen ihr Geld mit Komplettlösungen – Lagersysteme, Fördertechnik, Software, Service. Ein einzelner Roboterbaustein von einem Drittanbieter passt da nicht immer in das Geschäftsmodell bzw. hat nur eine geringe wirtschaftliche Relevanz.
Die Folge: Es gibt erfolgreiche Einzellösungen und Pilotprojekte, aber kein globaler Rollout in der Geschwindigkeit, die Analysten einst erwarteten.
Was die Branche gelernt hat
Die wichtigste Lektion der letzten Jahre lautet: Robotics Piece Picking ist kein Selbstzweck, sondern ein Baustein.
„Am Ende wollen die Kunden kein Stück Technologie kaufen, sondern verlässliche, skalierbare Fulfillment-Lösungen. Der Roboter ist nur ein Mittel zum Zweck.“, fasst Jentoft zusammen.
Damit verschiebt sich der Fokus. Nicht allein Pickraten oder Greifgenauigkeit zählen, sondern das Zusammenspiel von Technik, Prozessen und Wirtschaftlichkeit. Vor allem aber muss die Planung von Workflows einfacher werden. Heute sind Integrationsprojekte oft hochindividuell, weil jedes Lager andere Parameter hat – von der Frage, wie Artikel angeliefert werden, bis zu Details wie Verpackungsgrößen oder dem Handling leerer Behälter.
Leif Jentoft beschreibt es so: „Zu viel Arbeit steckt aktuell in der Integrationsschicht. RPP muss stärker als Produkt gedacht werden – Plug-and-Play statt Sonderlösung.“
Das bedeutet: Statt monatelanger Projektplanung, in der Prozesse, IT-Schnittstellen und physischen Abläufe mühselig angepasst werden, brauchen Kunden Standard-Workflows. Also klar definierte Szenarien, die ohne umfangreiche Anpassungen funktionieren – etwa für das automatische Befüllen von Sortertaschen, die Entnahme aus Totes oder das Handling standardisierter Verpackungen.
Eine vereinfachte Planung würde zwei Effekte bringen:
- Wirtschaftlichkeit – kürzere Projektlaufzeiten, geringere Kosten, schnellere Amortisation.
- Skalierbarkeit – die Möglichkeit, das System in mehreren Lagern oder Standorten fast identisch auszurollen, ohne jedes Mal bei Null zu starten.
Jentoft fasst es zusammen: „Planung muss simpel sein. Nur dann wird aus einer guten Technologie ein skalierbares Produkt.
Auch die Geschäftsmodelle haben sich angepasst. Während 2020 viele Anbieter auf Robotics-as-a-Service setzten, entscheiden sich heute mehr Kunden für klassische CAPEX-Investitionen. Gründe: steuerliche Abschreibungen, staatliche Förderungen, mehr Kontrolle über die Anlage. Service-Modelle bleiben interessant, haben aber nicht den Durchbruch gebracht, den viele erwarteten.
Prognosen und Realität: ein klarer Unterschied
Die historische Rückschau verdeutlicht, wie stark Prognosen danebenlagen. 2019 rechneten Studien mit Milliardenvolumina schon zur Mitte der 2020er. In der Realität sind wir davon heute weit entfernt.
Interact Analysis hat seine eigenen Vorhersagen entsprechend nach unten korrigiert: Statt 6,8 Milliarden bis 2030 werden nun rund 3,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Das ist immer noch starkes Wachstum, aber eben nicht die ursprünglich versprochene „Explosion“.
Für Jentoft ist die Erklärung klar: „RPP funktioniert in einzelnen Instanzen sehr gut. Aber die Breite kommt erst, wenn die Gesamtsysteme einfacher, zuverlässiger und wirtschaftlicher werden.“
Foundation Models als Beschleuniger der nächsten Stufe
Ein Bereich, der heute Hoffnung macht, sind Foundation Models. Anders als klassische KI-Ansätze, die jedes Objekt einzeln lernen mussten, können diese großen neuronalen Modelle generalisieren. Anhand von Milliarden von Bildern und Greifbewegungen trainiert, können sie eine größere Bandbreite an Aufgaben ausführen.
„Foundation Models könnten dafür sorgen, dass Roboter Aufgaben übernehmen, die wir uns vor ein paar Jahren kaum vorstellen konnten“, sagt Jentoft. Gemeint ist nicht nur besseres Picking, sondern vielleicht auch angrenzende Aufgaben: Objekte korrekt positionieren, Sonderfälle erkennen oder sogar Kartons nachschieben.
Konkret könnten Foundation Models:
- Selbstüberprüfung und ausgefeilte Wiederholungsstrategien ermöglichen, wenn ein Griff fehlschlägt.
- Weitere Fähigkeiten unterstützen, z. B. Kartonaufrichten oder das Einsetzen von Artikeln.
- Task-Chaining erlauben: Greifen → Ausrichten → Einsetzen in einen Karton, ohne dass separate Module nötig sind.
- Layout-Bewusstsein entwickeln, um Mindestabstände einzuhalten oder fragile Objekte korrekt zu platzieren.
Solche Fähigkeiten könnten die Integrationshürden deutlich senken, weil weniger Sonderlogik nötig ist und Ausnahmen reduziert werden.
Hier gibt es auch eine Brücke zur humanoiden Robotik. Viele Technologien, die für zweibeinige oder menschenähnliche Roboter entwickelt werden – Bewegungssteuerung, multimodale Wahrnehmung, Planungsfähigkeit – lassen sich in spezialisierte Picking-Roboter übertragen. „Vielleicht ist das eine der Triebfedern für RPP – die zugrundeliegenden Technologien für Humanoide adaptieren“, so Jentoft. Selbst wenn humanoide Roboter im Lager noch Zukunftsmusik sind, könnten ihre kognitiven Bausteine RPP beschleunigen.
Wie Verlässlichkeit messbar wird
Ein weiterer Lernschritt ist die Frage: Wie misst man eigentlich, ob ein RPP-System zuverlässig ist? Für Kunden reicht es nicht, wenn der Roboter greift – sie wollen stabile Prozesse.
Mögliche Kennzahlen:
- Order Accuracy: ≥ 99,9 Prozent Artikel, die präzise in den Auftragsbehälter überführt werden.
- Exception-Rate: ≤ 2 Fehler pro 1.000 Picks.
- Assist-Rate: ≤ 1 Prozent menschlicher Eingriffe.
- Pick-to-Place-Latenz (95. Perzentil): ≤ 2 Sekunden.
- Mean Time Between Assists (MTBA): mehrere Stunden.
- System-Uptime: ≥ 98,5 Prozent.
Solche KPIs könnten helfen, die Vergleichbarkeit zwischen Anbietern herzustellen und Vertrauen aufzubauen – etwas, das bislang fehlte. Insbesondere weil die Referenzen zum Vergleich nicht vorhanden waren.
Vom Hype zum nachhaltigen Wachstum
Die Geschichte von Robotics Piece Picking ist eine klassische Hype-Kurve. Zunächst überzogene Erwartungen, dann Ernüchterung – und nun eine Phase realistischen Wachstums. Statt Milliardenmarkt in 2025 sehen wir knapp ein Drittel einer Milliarde Dollar. Doch die Perspektive auf 3,3 Milliarden bis 2030 zeigt: Der Markt wächst, wenn auch langsamer.
Die Branche ist damit nicht gescheitert, sondern reifer geworden. Kunden erwarten keine Visionen, sondern Referenzen, Benchmarks und verlässliche Systeme. Erste Projekte etwa bei Active Ants, apo.com oder Ludwig Meister zeigen, dass Roboter mit großer Genauigkeit arbeiten und hunderte Picks pro Stunde liefern können. Der Schlüssel liegt darin, diese Erfolge zu standardisieren und in die Breite zu tragen.
Die zentrale Erkenntnis: Der Roboter ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Fulfillment-Systeme verlässlicher und skalierbarer zu machen. Oder wie es Jentoft ausdrückt: „Es geht nicht mehr darum, ob der Roboter picken kann. Es geht darum, ob das Gesamtsystem stabil, skalierbar und wirtschaftlich ist.“
Fazit
Robotics Piece Picking hat die Phase des Hypes hinter sich gelassen. Die Marktgrößen sind kleiner als einst prognostiziert, die Technologie ist reifer, die Erwartungen nüchterner. Foundation Models versprechen, Roboter vielseitiger zu machen und angrenzende Aufgaben zu übernehmen. Und während humanoide Roboter noch fern scheinen, liefern ihre Technologien wichtige Bausteine für spezialisierte Picking-Systeme.
Was zählt, ist nicht mehr die Frage, ob Roboter greifen können – das können sie. Entscheidend ist, ob sie in Gesamtsysteme eingebettet sind, die Prozesse wirklich vereinfachen, verlässlicher machen und wirtschaftlich tragfähig sind. Genau das ist es, was Kunden wollen: skalierbare Fulfillment-Lösungen, in denen der Roboter nur ein Mittel zum Zweck bleibt.
 „Damals war die Stimmung: Das Pick-Problem ist gelöst, jetzt geht es nur noch um das Ausrollen. Aber so einfach war und ist es nicht.“, meint Leif Jentoft, Robotics Experte, Co-Founder und früherer CSO von RightHand Robotics.
„Damals war die Stimmung: Das Pick-Problem ist gelöst, jetzt geht es nur noch um das Ausrollen. Aber so einfach war und ist es nicht.“, meint Leif Jentoft, Robotics Experte, Co-Founder und früherer CSO von RightHand Robotics.