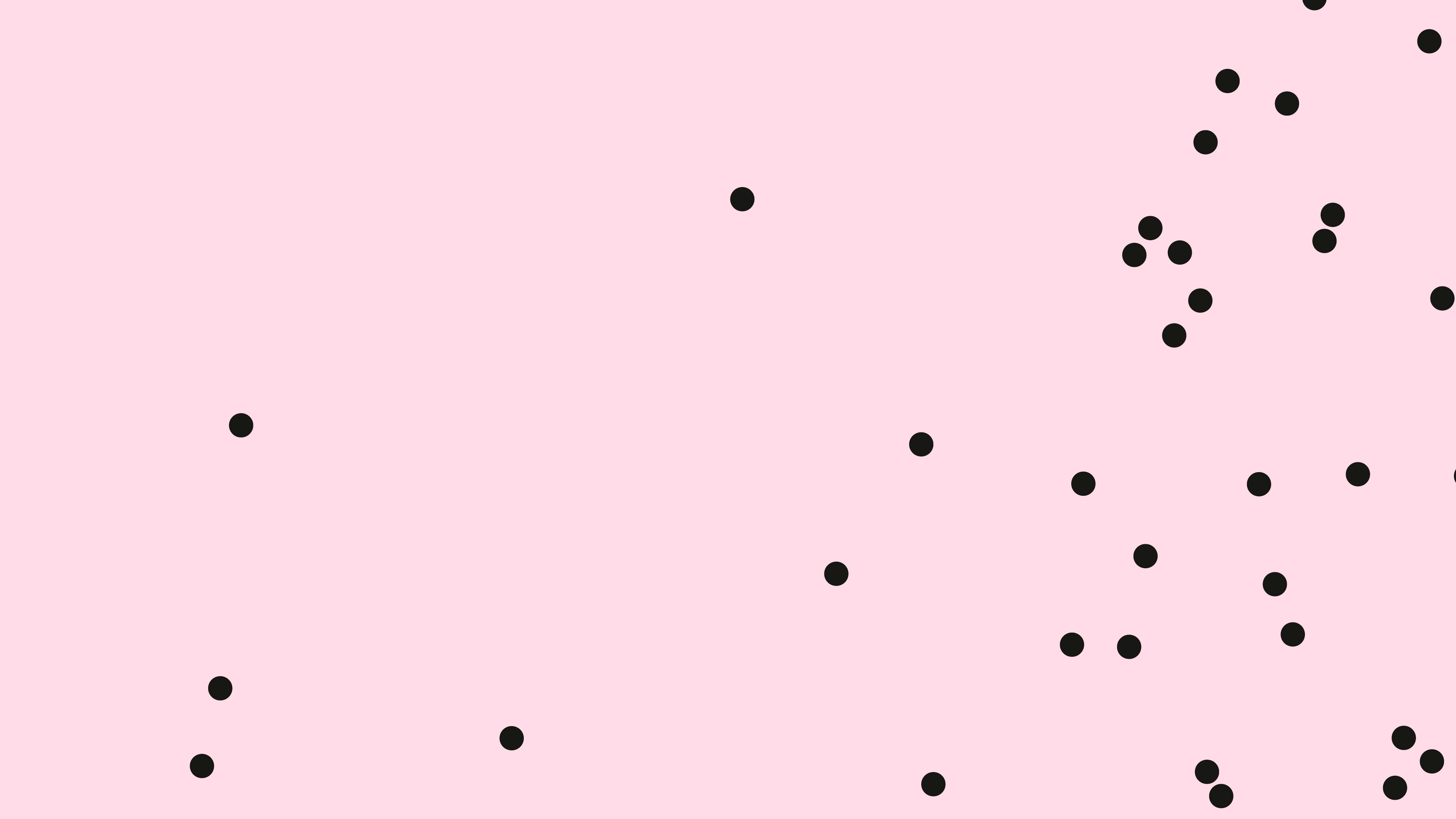- Hardware
- Automatisierung
- Wissen
Robotic Piece Picking: Komponenten, Technologien und der Unterschied zwischen Cobots und Industrierobotern
Robotic Piece Picking schließt die letzte Lücke in der Logistikautomatisierung und zeigt, welche Technologien den Unterschied machen.
In a nutshell: Robotic Piece Picking (RPP) bringt das automatische Greifen einzelner Artikel in die Praxis – zuverlässig, schnell und mit hoher Genauigkeit. Die Hardware wie Kameras oder Roboterarme ist weitgehend austauschbar, den Unterschied machen Vision-KI, intelligente Greifer mit Werkzeugwechslern und eine smarte Steuerungssoftware. Industrieroboter bieten dabei meist die robustere Lösung, während Cobots nur in speziellen Szenarien Vorteile haben. Kurz gesagt: RPP schließt die letzte Lücke zur vollständig automatisierten Logistik.
Warum Piece Picking die Königsdisziplin der Logistik ist
Automatisierung ist längst Alltag in der Logistik. Förderanlagen, Shuttlesysteme, automatische Hochregallager und kompakte Cube-Systeme wie AutoStore haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Materialflüsse effizienter, schneller und transparenter werden. Doch trotz aller Fortschritte blieb eine Aufgabe erstaunlich lange dem Menschen vorbehalten: das Greifen einzelner Artikel – im Fachjargon „Piece Picking“.
Auf den ersten Blick wirkt diese Tätigkeit simpel. Ein Mitarbeiter nimmt ein Buch, eine Medikamentenschachtel oder ein T-Shirt aus einem Behälter und legt es in einen Auftrag. Doch gerade diese scheinbar banale Tätigkeit entpuppte sich über Jahre hinweg als größte Hürde für die Automatisierung. Artikel unterscheiden sich in Form, Gewicht, Oberfläche und Stabilität. Manche sind klein und glatt, andere empfindlich, wieder andere liegen chaotisch übereinander. Während Menschen all diese Variationen intuitiv meistern, waren Roboter lange nicht in der Lage, diese Vielfalt zuverlässig zu bewältigen.
Mit dem Aufkommen von Robotic Piece Picking (RPP) ändert sich dieses Bild. Fortschritte in der Bilderkennung, im maschinellen Lernen und in der Greifertechnologie eröffnen heute Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen. Roboter sind inzwischen in der Lage, auch unbekannte Produkte zuverlässig zu identifizieren, den besten Greifpunkt auszuwählen und den Artikel sicher zu platzieren. Damit wird die letzte Lücke zwischen vollautomatischem Lagersystem und digitalisiertem Auftragsprozess geschlossen.
Doch wie funktioniert Robotic Piece Picking im Detail? Welche Komponenten sind unverzichtbar, welche lassen sich austauschen, und wo liegen die echten Differenzierungsmerkmale? Genau diesen Fragen widmet sich der folgende Beitrag.
Was versteht man unter Robotic Piece Picking?
Robotic Piece Picking bezeichnet die Fähigkeit eines Roboters, einzelne Produkte aus einem chaotisch befüllten Quellbehälter zu entnehmen und gezielt in einen Zielbehälter oder eine Verpackung zu legen. Damit ist RPP die logische Weiterentwicklung automatisierter Lagersysteme, die bisher zwar Behälter transportieren konnten, aber beim eigentlichen Picken auf menschliche Hände angewiesen waren.
Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert: In E-Commerce-Lagern beschleunigt RPP die Bearbeitung von Online-Bestellungen. In der Pharma- und Healthcare-Branche sorgt es für Präzision und Hygiene bei der Kommissionierung sensibler Produkte. In Retail-Distribution und Produktion kann der Roboter einzelne Artikel für Filialen oder Montagelinien bereitstellen.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Mit RPP-Systemen lassen sich Prozesse standardisieren, Fehler reduzieren und die Produktivität erhöhen. Vor allem aber schaffen sie Resilienz in einer Zeit, in der Arbeitskräftemangel und steigende Anforderungen an Geschwindigkeit die Logistik unter Druck setzen.
Die Bausteine eines RPP-Systems
Damit ein Roboter einzelne Artikel zuverlässig greifen kann, braucht es das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Jede übernimmt eine klar definierte Rolle, und erst im Zusammenspiel entsteht ein leistungsfähiges System.
Vision-Systeme: Die Augen des Roboters
Das Vision-System ist die erste Station jedes Picks. Es liefert dem Roboter die Informationen, die er benötigt, um überhaupt handeln zu können. Typischerweise kommt eine Kombination aus hochauflösender Kamera und 3D-Sensor zum Einsatz. Die Kamera liefert Farb- und Formdaten, der 3D-Sensor erfasst Tiefeninformationen und erkennt so, wo Artikel im Raum liegen.
Die wahre Differenzierung liegt hier jedoch in der Software. Sie verwandelt die Rohdaten in verwertbare Informationen: Welcher Artikel liegt im Quellbehälter? Welche Position eignet sich am besten für den Greifer? Und wie kann verhindert werden, dass benachbarte Artikel im Weg sind? Moderne Systeme nutzen dafür Deep-Learning-Algorithmen, die nicht nur bekannte, sondern auch völlig unbekannte Produkte verarbeiten können. Dieser Ansatz wird oft als Zero-Shot Reasoning bezeichnet, weil das System in der Lage ist, ohne vorheriges spezifisches Training auf ein neues Objekt sofort eine Greifentscheidung zu treffen. Damit entfällt die aufwändige Notwendigkeit, jedes einzelne SKU vorab anzulernen. Für die Praxis bedeutet das, dass Roboter auch in hochdynamischen Sortimenten oder bei ständig wechselnden Produkten zuverlässig eingesetzt werden können.
Die Kamerahardware selbst gilt heute weitgehend als Commodity. Viele Hersteller bieten ähnliche Qualität, und Unterschiede zwischen Stereo- oder Structured-Light-Sensoren sind für die Gesamtleistung oft zweitrangig. Entscheidend ist, wie gut die Software die erfassten Daten interpretiert und in praktikable Greifpunkte übersetzt. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Anbieter mit ausgereifter KI erzielen höhere Erkennungsraten und damit eine deutlich bessere Praxistauglichkeit.
Roboterarme: Die Muskeln des Systems
Während das Vision-System die Augen darstellt, übernimmt der Roboterarm die Rolle der Muskeln. Er setzt die Anweisungen der Software um, positioniert den Greifer präzise und bewegt den Artikel von A nach B.
In der Praxis kommen zwei unterschiedliche Typen zum Einsatz: kollaborative Roboter (Cobots) und klassische Industrieroboter. Cobots sind für die Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt. Sie verfügen über integrierte Sicherheitstechnik, reagieren sensibel auf Berührungen und stoppen sofort bei einer Kollision. Ihr großer Vorteil liegt in der Flexibilität: Sie lassen sich schnell umprogrammieren, einfach in bestehende Arbeitsplätze integrieren und erfordern keine aufwendigen Sicherheitszäune.
Industrieroboter verfolgen einen anderen Ansatz. Sie sind für maximale Geschwindigkeit, Traglast und Präzision optimiert. In geschützten Zellen erreichen sie eine Performance, die Cobots deutlich übertrifft. Allerdings sind sie nicht für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen konzipiert und erfordern daher mehr Raum und ein separates Sicherheitskonzept.
Die Hardware der Roboterarme gilt mittlerweile als weitgehend standardisiert. Hersteller wie Fanuc, KUKA, ABB, Yaskawa oder Universal Robots bieten Modelle, die in ihren Grundfähigkeiten vergleichbar sind. Die eigentliche Differenzierung entsteht durch die Wahl des passenden Robotertyps. Während Cobots mit ihren eingebauten Sicherheitssensoren und ihrer einfachen Programmierbarkeit oft als ideale Lösung für Brownfield-Szenarien dargestellt werden, sollte man diese Einschätzung im Kontext von Piece Picking kritisch hinterfragen. In der Praxis arbeiten die meisten RPP-Systeme ohnehin autark und ohne direkten Mensch-Roboter-Kontakt. Tritt eine Störung auf, muss auch ein Cobot pausieren, bis ein Mitarbeiter eingreift – die kollaborativen Sicherheitsfunktionen spielen in diesem Fall kaum eine Rolle.
Industrieroboter bieten dagegen in den meisten Anwendungsfällen die bessere Performance, da sie höhere Geschwindigkeiten und Pickraten erreichen. Ihre Sicherheit lässt sich über Umhausungen oder Lichtgitter genauso zuverlässig gewährleisten.
Cobots bleiben dort interessant, wo schnelle Umrüstungen, einfache Bedienung oder Pilotprojekte im Vordergrund stehen. Für den langfristigen Betrieb in Hochleistungssystemen sind jedoch klassische Industrieroboter meist die robustere Wahl.
Greifertechnologie: Die Hand, die den Unterschied macht
Noch entscheidender als die Wahl des Arms ist die Wahl des Greifers. Er ist die Hand des Systems und die physische Schnittstelle zwischen Roboter und Artikel. Hier entscheidet sich, ob ein Pick gelingt oder scheitert.
Einfache Vakuumgreifer eignen sich hervorragend für glatte Oberflächen wie Bücher oder Kartons. Mechanische Greifer mit Fingern oder Klauen sind ideal für unregelmäßig geformte oder poröse Artikel. Am leistungsfähigsten sind jedoch hybride Systeme, die beide Prinzipien kombinieren. Moderne Robotic-Piece-Picking-Systeme setzen zunehmend auf Werkzeugwechsler, die es ermöglichen, verschiedene Greiferarten in einem System zu kombinieren. Was früher als Premium-Option galt, entwickelt sich heute zum Standard. Denn nur so können Roboter die gesamte Bandbreite an Artikeln zuverlässig handhaben – von glatten Verpackungen bis zu unregelmäßigen Objekten.
Der Werkzeugwechsler erlaubt es dem Roboter nicht nur, unterschiedliche Produkte zu greifen, sondern auch Fehler selbstständig zu korrigieren: Gelingt ein Pick mit dem Saugnapf nicht, kann der Roboter direkt auf einen Finger- oder Hybridgreifer wechseln. Dadurch steigen Erfolgsquote und Autonomie erheblich. Für Unternehmen bedeutet das weniger manuelle Eingriffe, höhere Pickraten und eine insgesamt robustere Systemperformance. Entscheidend ist dabei nicht nur die Mechanik des Werkzeugwechslers, sondern auch die Intelligenz der Steuerungssoftware, die in Sekundenbruchteilen entscheidet, welches Werkzeug in welchem Moment zum Einsatz kommt.
Zusätzliche Sensorik macht den Greifer intelligent. Unterdrucksensoren prüfen, ob ein Vakuum tatsächlich aufgebaut wurde. Taktilsensoren erkennen, ob ein Artikel sicher gehalten wird. Manche Systeme nutzen sogar Kameras direkt am Greifer, um die Position noch präziser abzustimmen.
Während einfache Saugnäpfe oder Standardmechaniken als Commodity betrachtet werden können, liegt die wahre Differenzierung in maßgeschneiderten, intelligenten Greifern. Sie sind in der Lage, die enorme Artikelvielfalt moderner Lager zuverlässig abzudecken. Anbieter, die eigene Greifer entwickeln und mit Sensorik kombinieren, schaffen damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Steuerungs- und Kontrollsoftware: Das Gehirn hinter den Bewegungen
Die Steuerungssoftware ist das unsichtbare Gehirn des Systems. Sie verbindet die Erkenntnisse des Vision-Systems mit den Fähigkeiten des Roboterarms und des Greifers. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Bewegungen zu planen, Kollisionen zu vermeiden und den gesamten Ablauf so zu optimieren, dass möglichst viele Picks pro Stunde erreicht werden.
Doch damit nicht genug: Die Software entscheidet auch über die Auswahl der passenden Greifstrategie, überwacht den Erfolg eines Picks und steuert, was bei Fehlern passiert. Wenn ein Artikel nicht erfolgreich gegriffen wird, muss das System entscheiden, ob ein zweiter Versuch gestartet oder der Artikel aussortiert wird.
Darüber hinaus ist die Steuerungssoftware die Schnittstelle zur IT-Welt. Über Anbindungen an Lagerverwaltungssysteme (WMS) oder Warehouse Control Systeme (WCS) erhält der Roboter seine Aufträge und meldet zurück, welche Artikel bereits kommissioniert wurden.
Basis-Frameworks wie ROS oder die nativen APIs der Roboterhersteller sind heute Commodity. Der Unterschied entsteht durch die proprietären Erweiterungen der Anbieter. Sie bestimmen, wie robust ein System arbeitet, wie effizient es Fehler handhabt und wie tief es sich in bestehende Prozesse integrieren lässt. Hier liegt ein entscheidender Teil der Wertschöpfung, denn nur mit einer intelligenten Software wird aus einem Roboter ein produktives Piece-Picking-System.
Integration in Logistikprozesse: Der unterschätzte Erfolgsfaktor
Ein RPP-System entfaltet seinen Nutzen erst dann voll, wenn es nahtlos in die umgebenden Logistikprozesse integriert wird. Dazu gehört die mechanische Integration in Fördertechnik und Lagerlayouts ebenso wie die softwareseitige Anbindung an bestehende Systeme.
In der Praxis bedeutet das: Ein automatisches Lagersystem bringt den Quellbehälter zum Roboter. Dieser entnimmt die Artikel, platziert sie in einen Zielbehälter und die Fördertechnik transportiert sie weiter zur Verpackung. Gleichzeitig muss das WMS wissen, welche Artikel bereits verarbeitet wurden und welche noch fehlen.
Anbieter, die Plug-and-Play-Schnittstellen anbieten und über Erfahrung in der Prozessintegration verfügen, schaffen hier einen klaren Mehrwert. Denn schlechte Integration führt schnell zu Insellösungen, während gute Integration den Roboter zu einem produktiven Teil des Gesamtsystems macht.
Commodity vs. Differenzierung: Wo entsteht echter Mehrwert?
Ein Blick auf alle Komponenten zeigt: Kameras, Standardarme und einfache Greifer sind austauschbar. Sie gelten als Commodity und lassen sich von verschiedenen Herstellern beziehen.
Die echte Differenzierung entsteht an anderen Stellen: in der Vision-Software mit ihren KI-Algorithmen, in intelligenten Greifern mit Sensorik, in proprietären Steuerungslösungen und in der Integrationskompetenz des Anbieters. Diese Faktoren entscheiden darüber, ob ein RPP-System in der Praxis zuverlässig arbeitet, hohe Pickraten erreicht und sich reibungslos in bestehende Prozesse einfügt.
Best Practices für Unternehmen
Unternehmen, die über den Einsatz von RPP nachdenken, sollten einige Grundregeln beachten. Wichtig ist, Pickraten unter realen Bedingungen zu prüfen und nicht nur Laborwerte zu betrachten. Ebenso sollte die Artikelvielfalt in den Mittelpunkt der Bewertung gestellt werden. Je heterogener das Sortiment, desto wichtiger sind intelligente Greifer und starke Vision-Systeme.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die frühzeitige Integration. Schnittstellen zum WMS und die mechanische Einbindung in die Fördertechnik sollten nicht erst am Ende des Projekts geplant werden. Auch die ROI-Betrachtung muss realistisch sein: Neben Investitionskosten spielen Betriebskosten, Wartung und Mitarbeiterentlastung eine Rolle.
Pilotprojekte bieten eine gute Möglichkeit, Risiken zu minimieren und erste Erfahrungen zu sammeln. Sie ermöglichen es, Systeme unter Praxisbedingungen zu testen, bevor sie skaliert werden.
Auf der Suche nach einer passenden Lösung für deine Logistik? Hier geht’s zur Vergleichsplattform, die dir die Suche erleichtert.