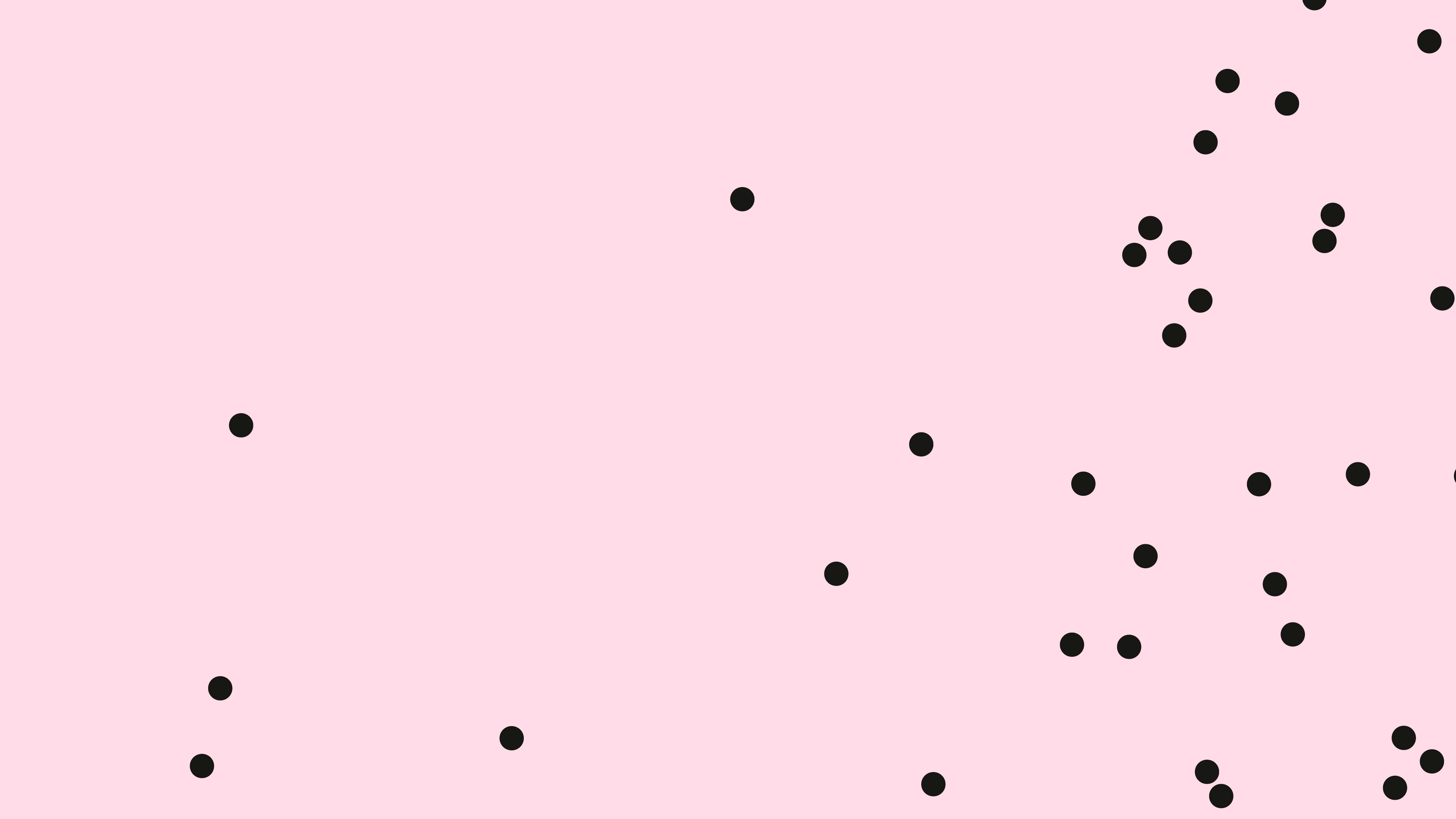- Interview
- Automatisierung
Die Fabrik der Zukunft kommt ohne humanoide Roboter aus
Im Gespräch mit Daniel Küpper von der Boston Consulting Group über den Einsatz von KI und Robotik in der Produktion.

In a nutshell: Daniel Küpper, Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group, gibt im Gespräch Einblicke in den technologischen Wandel in der Produktion. Von virtuellen KI-Agenten über die nächste Generation der Robotik bis hin zur Vision einer menschenleeren Fabrik – Küpper erklärt, was heute schon möglich ist, wo die größten Hürden liegen und warum nicht jede futuristische Technologie am Ende einen echten Business Case hat.
Andreas: Welche Trends und Innovationen sehen wir aktuell in der Produktion und in der Fabrik der Zukunft? Was ist dein Lieblingstrend?
Daniel: Das große Thema ist Künstliche Intelligenz. Sie treibt viele Veränderungen und ist aus meiner Sicht ein grundlegender Treiber. Es gibt zwei große Bereiche: Zum einen virtuelle KI-Agenten – kleine Helferprogramme, die Ereignisse beobachten, Entscheidungen treffen und daraus Aktionen ableiten. Zum anderen „embodied AI“, also KI, die physische Prozesse steuert, zum Beispiel in der Robotik.
KI-Trends und virtuelle Agenten
Wenn wir bei den virtuellen Agenten bleiben: Sind diese in der Industrie schon weit verbreitet, oder ist das noch Zukunftsmusik?
Weit verbreitet sind sie noch nicht. Wir haben seit Industrie 4.0 viele Daten gesammelt. Zuerst ging es um Transparenz: zu wissen, wo Engpässe sind, und darauf reagieren zu können. Später kamen Advanced-Analytics-Anwendungen hinzu – bessere Produktionsprognosen, vorausschauende Wartung. Der nächste Schritt ist die autonome Fabrik. Dafür braucht es genau diese intelligenten Agenten, die Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren und Entscheidungen treffen, damit eine Fabrik wirklich autonom arbeitet.
Robotik – vom Programmieren zum Trainieren
Lass uns über Robotik sprechen. Wie hat sich diese in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
In den 1960er-Jahren war alles strikt regelbasiert: „Wenn X, dann Y“. Jede neue Aufgabe brauchte eine eigene Programmierung, oft in herstellerspezifischen Sprachen. Vor rund 15 Jahren kam die Kombination aus Roboterarmen, Kameras und maschinellem Lernen. Damit konnten Roboter erstmals durch Training neue Fähigkeiten erlernen. Am Anfang war das reines „Trial and Error“ am echten Roboter, heute trainieren wir fast ausschließlich in virtuellen Umgebungen.
Was sind die Vorteile des virtuellen Trainings?
Wir können Trainings tausendfach parallelisieren. Früher brauchte man für 1.000 Trainingsdurchläufe Wochen, heute schaffen wir das in Stunden und mit deutlich höherer Präzision. So lassen sich Systeme besser auf den Serieneinsatz vorbereiten. Die nächste Stufe sind „Robotic Foundation Models“. Diese nutzen Kontextwissen und können Aufgaben ohne spezielles Anlernen umsetzen. Ähnlich wie große Sprachmodelle, nur für Robotik.
Autonome Fabrik
Wie nah sind wir an einer menschenleeren Fabrik?
Technisch sind wir in der direkten Fertigung schon sehr weit. Ausnahmen sind komplexe Reparaturen oder Instandhaltung. Da fehlt mir kurzfristig die Fantasie. Aber einfache Reinigungs- oder Inspektionsaufgaben werden wir automatisieren können. Neben der technischen Frage ist die wirtschaftliche entscheidend: Die Investition muss sich rechnen. In Deutschland lohnt sich das vor allem dort, wo wir hohe Lohnkosten einsparen und unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern können.
Manche sehen Automatisierung kritisch, weil sie Arbeitsplätze kosten könnte.
Ich sehe das Gegenteil: Automatisierung ist nötig, um Arbeitsplätze zu halten. Nur wenn wir produktiver werden, können wir unseren Wohlstand sichern und ausbauen. Gerade in Deutschland müssen wir massiv investieren, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Humanoide Roboter
Humanoide Roboter sind gerade ein Hype. Werden sie in der Fabrik eine Rolle spielen?
Meiner Meinung nach nicht. Sie sind zu teuer, zu komplex und erfüllen nicht die Sicherheitsanforderungen für den industriellen Einsatz. In der Produktion gibt es keine Treppen, über die ein Roboter auf zwei Beinen steigen müsste. Mobile Plattformen mit Roboterarmen sind viel effizienter und günstiger. Humanoide Roboter, wie wir sie aktuell kennen, würden außerdem keine Zulassung in Fabriken erhalten, weil sie zu schwer und instabil sind. Stattdessen brauchen wir robuste, zweckmäßige Systeme, die für klar definierte Aufgaben optimiert sind. Warum sollte ein teures System Zeit damit verbringen, Materialien zwischen Stationen zu transportieren, wenn das günstiger und sicherer mit einfachen Transportfahrzeugen geht? Die Flexibilität humanoider Roboter klingt interessant, rechtfertigt die hohen Kosten aber in den meisten Anwendungsfällen nicht.
Warum investieren Unternehmen trotzdem in Pilotprojekte?
Häufig aus Marketinggründen oder um Technologien im kleinen Rahmen zu erproben. Natürlich bin ich gespannt, wohin sich das entwickelt, und vielleicht reden wir in zehn Jahren anders darüber. Aber derzeit sehe ich den Einsatz in der Breite nicht. Für die wenigen Fälle, in denen Flexibilität wirklich entscheidend ist, kann man auch andere Lösungen entwickeln, zum Beispiel Roboterarme auf autonomen Plattformen montieren.
Was nimmst du als wichtigste Botschaft für die Zukunft mit?
KI und Robotik entwickeln sich rasant, und wir werden in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte sehen. Systeme werden präziser, flexibler und in der Lage sein, mehr Entscheidungen eigenständig zu treffen. Aber nicht jede Technologie, die beeindruckend aussieht, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Entscheidend ist, dass sie einen klaren Nutzen bringt und sich rechnet.
👉 Neugierig geworden? Dann hör dir die ganze Folge an!
YouTube: https://youtu.be/xsrK_LtoNUk
Spotify: https://spoti.fi/3QoklPd