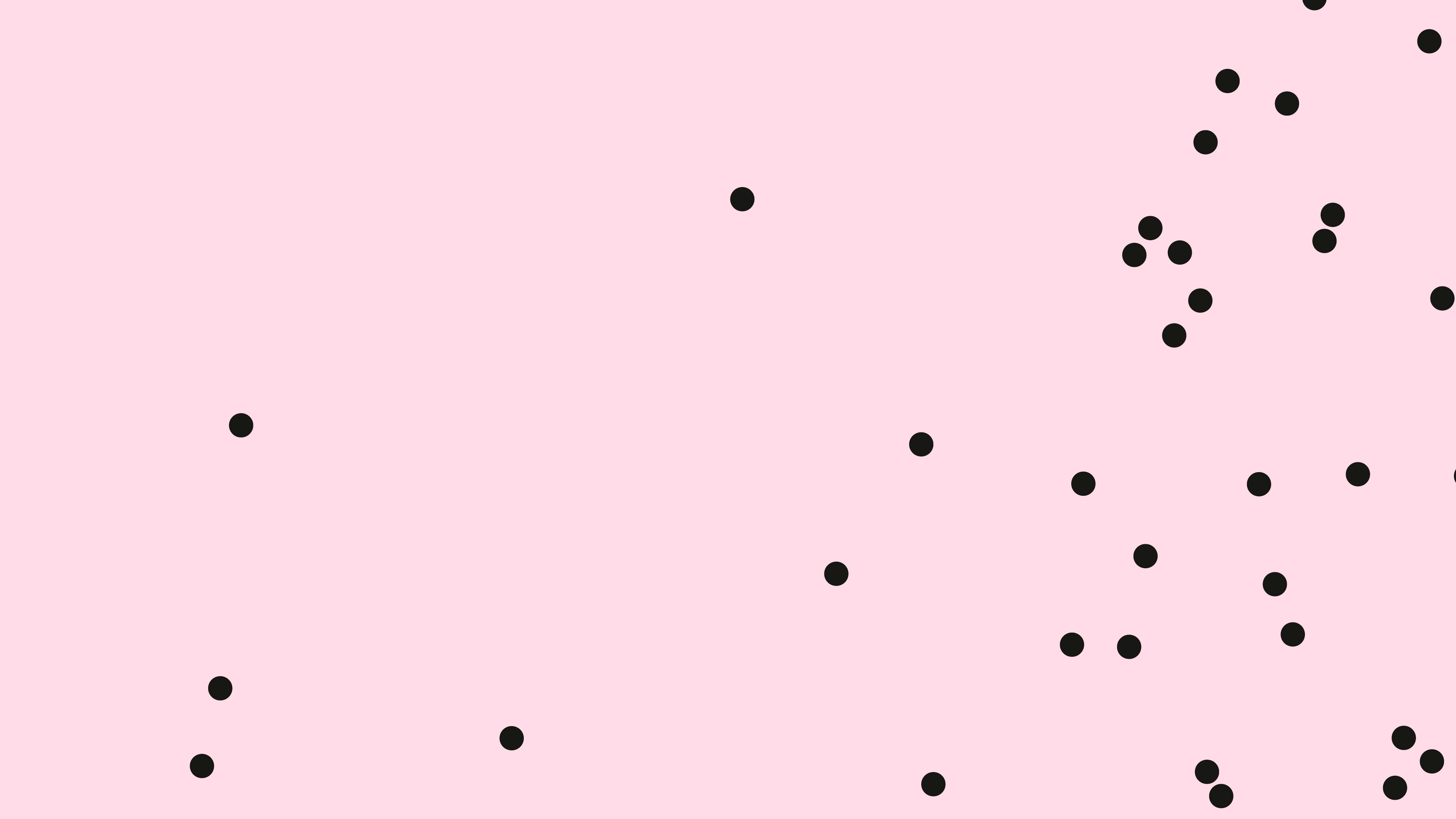- Nachhaltigkeit
- Wissen
Nachhaltigkeit und Logistik - Die Circular Economy und Reverse Logistics
Re-Re-Reverse when the economy says “Bo’ selecta”!
In a nutshell: Return! Retour! Reverse Logistics! Einmal linear und wieder zurück. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber in meinen beruflichen Anfangsjahren ertönte immer ein kollektives Stöhnen, wenn es um Retourenprozesse ging. Das hässliche Entlein unter den (intra)logistischen Prozessen wird sich im Sinne der Circular Economy zum strahlend schönen Schwan entwickeln. Mit diesem Blogpost möchte ich also den längst überfälligen gläsernen Schuh liefern für das Aschenputtel der Logistik: Returns, Retouren oder neu-englisch Reverse Logistics!
Disclaimer: In zwei früheren, vorangegangen Blogposts habe ich die Circular Economy mal grundsätzlich beschrieben und eingeordnet. Wer das also nochmal nachholen möchte (oder ggf. sogar muss), der findet hier den Link zum 1. Teil der Reihe und hier den Link zu dem 2. Teil.
Return, Baby! Return!
Return, Retour, Reverse. Die Marketing-Abteilung hat ganze Arbeit über die Jahre geleistet. Sounds like: Alter Wein in neuen Schläuchen. Und zusätzlich: Retoure ist nicht gleich Retoure. Die Rückführungsprozesse können im Allgemeinen eine Vielzahl an unterschiedlichen Subprozessen mit einer entsprechenden Motivationsdiversität bieten: klassische Rücksendungen, Reparaturen, Recycling oder Entsorgung.
Wir Logistiker kennen sie alle. Und der Klassiker: die klassische Rücksendung. Szenario: Ein Kunde möchte die (online) gekaufte Ware - warum auch immer - nicht mehr. „Geil! Wir kriegen die Ware wieder!“ ist wahrscheinlich in diesem Fall ein äußerst seltener Satz seitens eines Händlers. Insofern verwundert es auch nicht, dass ein solcher Prozess - überspitzt gesagt - ein Imageproblem hat. Die gesamte Rückabwicklung dessen kostet schließlich Geld. Und zuweilen kam es in meiner Vergangenheit vor - und ich unterstelle mal, dass es heute immer noch der Fall ist -, dass es billiger war, die Ware nicht wieder entgegenzunehmen, und die Rückerstattung einfach so zurückzuüberweisen. „Ach, behalte das einfach.“ oder „Mach damit, was du willst. Tüss!“ waren die läppischen Kommentare dazu. Das folgende Symbolbild soll das Prinzip verdeutlichen:

Aber warum sind die Rückführungsprozesse so „teuer“ bzw. das Wegschmeißen so billig? Schauen wir uns das mal näher an.
Externalisierte Kosten und Total Cost of Ownership (TCO)
Der gesamte Rückführungsprozess ist die Mutter aller logistischen Prozesse, die unter den Folgen des Phänomens der „externalisierten Kosten“ leiden. Externalisierte Kosten? Hört sich irgendwie nach BWL 2. Semester an und klingt niedlicher als es eigentlich ist.
Externalisierte Kosten sind Kosten, die von Produzenten verursacht, aber von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Kosten zu externalisieren bedeutet, dass Unternehmen höhere Profite machen, während letztlich die Gesellschaft den Preis dafür zahlt. Der Klimawandel und die Globale Erwärmung ist als sogenanntes Hyperobjekt ein Resultat dessen. Unverhältnismäßig viel CO2 in die Atmosphäre ballern führt zur Intensivierung des Treibhauseffekts führt zu Globale Erwärmung. Davon haben wir alle was. Yeah. Trickle-Down-Effekt, Baby, aber so richtig. Unser heutiges Wirtschafts- und Finanzsystem belohnt paradoxerweise diese Handlungsweise. [3]
Aber wieso eigentlich paradox? Jetzt wird es ganz wild. Haltet euch fest. Denn Unternehmen sind eigentlich dem Gesetze nach „verpflichtet“, dem Gemeinwohl entsprechend zu wirtschaften. WHAAAAT??? Ich weiß, ich weiß. Klingt nach dem absoluten Gegenteil des Shareholder Values, den wir vor allem bei großen Konzernen und Aktiengesellschaften beobachten dürfen. Und irgendwie klingt das wie der linke feuchte Traum. Aber wo steht das eigentlich: „dem Gesetz verpflichtet“? Schaut mal hier:
Artikel 151 der bayerischen Verfassung: „(1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten.“ [4] Ja sicher. In der Verfassung von König Maggus, dem I, dem Ehrenvorsitzen des Fähnlein-im-Wind-Fieselschweif Clubs. Das hättet ihr nicht gedacht, was. Gut, zugegeben: Er hat das nicht geschrieben und ich bezweifle auch, dass er den Artikel kennt.
Aber nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Ländern stehen solche Passagen, bspw. in Italien. Artikel 41 der Verfassung der Italienischen Republik: „Die Privatinitiative in der Wirtschaft ist frei. Sie darf sich aber nicht im Gegensatz zum Nutzen der Gesellschaft oder in einer Weise, die die Sicherheit, Freiheit und menschliche Würde beeinträchtigt, betätigen.“ [5]
Irgendwie klingt der Begriff „externalisierte Kosten“ in diesem Zusammenhang für mich nach Euphemismus, oder? Bisweilen entsteht doch sogar ein völlig aus den Fugen geratene Idolisierung von Geschäftsleuten und Unternehmen. Die (sehr oft) diesem Prinzip innewohnende Skrupellosigkeit wird völlig ausgeblendet und der wirtschaftliche Erfolg gemessen an der Größe der Zahl auf dem Bankkonto respektive des Order Intakes als ökonomische Genialität eingeordnet und abgefeiert.
Der Gegenentwurf zu der Externalisierung von Kosten ist im Übrigen das Prinzip „Total Cost of Ownership (TCO)“. Unter der TCO versteht man die Summe aller für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes, seine Nutzung und ggf. für die Entsorgung anfallenden Kosten. Und im Grunde ist der CO2-Preis eine Brücke vom Prinzip der externalisierten Kosten zu einer TCO-Betrachtung.
So, also alle mal wieder runterkommen. Und ich natürlich auch. Das Thema ist wirklich komplex und nicht so einfach lösbar, wie ich ggf. hier für den Lesenden darstelle. Aber abseits meines kleinen Rants, was hat das denn nun mit Reverse Logistics zu tun? Nun ja, kurz zusammengefasst haben die Rückführungsprozesse und die Wirtschaftlichkeit dessen haben einen viel zu schweren Stand gegenüber den etablierten Prozessen einer linearen Wirtschaftsweise.
Einerseits sind die Versand- und Transportkosten generell zu niedrig (hierzu habe ich bereits indirekt in meinem Blogpost über den Wert der Logistik geschrieben) [6] und in Anbetracht der zusätzlichen unerwünschten Belastungen für Gesellschaft und Umwelt (Reifenabrieb und insbesondere Emissionen) ebenfalls nicht mal ansatzweise adäquat integriert, wenn wir das aus der TCO-Brille betrachten. Und andererseits, und das ist entscheidender, tragen wir alle die Entsorgungskosten. Diese Kosten dürfen aber eigentlich nicht länger den Kommunen, also uns (über Steuern), aufgebürdet werden. Das gilt insbesondere für den florierenden Online-Handel. Die Städte dürfen nicht länger Amazon & Co zwangssubventionieren müssen, indem sie die Kosten der Entsorgung vor allem des Verpackungs- und zusätzlich in Teilen des generellen Abfalls schultern. [7]
Kleiner Exkurs: Die Sneakerjagd
Vor ein paar Jahren hat das Medien-Startup und Recherche-Kollektiv Flip sich folgende Frage gestellt: Was passiert mit den Millionen Schuhen, die wir jedes Jahr aussortieren? Daraufhin hat Flip alte Sneaker von Prominenten (u.a. Jan Delay, Carolin Kebekus, etc.) verwanzt und via GPS-Recherche nachverfolgt. Mit der Sneakerjagd sorgte das Hamburger Startup bundesweit für Schlagzeilen und zeigte, was bei den Rückführungsprozessen alter Schuhe alles im Argen liegt. Die Sneakerjagd erzählt so viele Geschichten: das alles könnt ihr hier nachlesen [8] oder einfach anschauen [9].
Oder hier reinhören, denn in Podcast Folge 33 von „Das Gleiche in Grün?!“ war Felix Rohrbeck von besagtem Medien-Startup Flip zu Gast:

Die Kosten von Rücknahmemechanismen stellen oft eine der größten Herausforderungen für Unternehmen dar. Und dementsprechend auch für Unternehmen die sich mit Kreislaufkonzepten befassen. In diesem Zusammenhang sind also zirkuläre Geschäftsmodelle für Produktrücknahmesysteme zwingend notwendig, die ökonomisch betrachtet nicht nur gegen dieses Throwaway-Prinzip konkurrieren, sondern sich auf lange Sicht auch dagegen durchsetzen können.
Auch hier bin ich überzeugt, dass genau das in vielen Bereichen automatisch passieren wird (Rohstoffverknappung und die Folgen). Aber wir brauchen den politischen und wirtschaftlichen Willen dazu, weil die Zeit drängt (s. auch hierzu mein Kommentar zur Technologieoffenheit).
Im Folgenden werden wir uns nun mal ein paar Reverse-Praktiken angucken und aufzeigen, wo welche Potenziale liegen, und welche Rolle die Logistik einnehmen soll / wird.
Reverse Logistics
Die Circular Economy schlägt einen Paradigmenwechsel hin zur Rückwärtslogistik (=Reverse Logistics) vor. In diesem neuen, alten Modell wird ein Produkt nach Ablauf seiner „Nutzungsdauer“ (wird leider heutzutage sehr dehnbar interpretiert) für den Verbraucher wieder in die Lieferkette des Unternehmens integriert, um wiederverwendet, recycelt oder wiederaufbereitet zu werden. Aber auch die in den verschiedenen Supply Chain Prozessen anfallenden „Sekundärrohstoffe“ (früher und weitestgehend heute immer noch als „Abfälle“ bezeichnet) müssen in die Circular Economy integriert werden.
Daraus ergeben sich wiederum einige Implikationen für die Supply Chain und eben auch für die Logistik. Retouren- und Rücknahmeprozesse sind nervige und oftmals vernachlässigte Elemente der Supply Chain. Denn wie bereits erwähnt ist es ökonomisch betrachtet heute immer noch billiger retournierte Waren zu entsorgen als sie teuren Rücknahme- und Qualitätskontrollprozessen auszusetzen.
Schauen wir uns einige Bereiche der Reverse Logistics genauer an:
- Die klassische Retoure in der Zukunft
- Urban Mining (Sekundärrohstoffe)
- Reparatur
- Sharing Economy
Reverse Logistics: Die klassische Retoure in der Zukunft (VAS)
Gehen wir also davon aus, dass es in Zukunft nicht mehr billiger sein wird, ein Produkt wegzuschmeißen. Ja, ich weiß. Das ist nicht für alle Produkte möglich und sinnvoll. Das Ansinnen soll ja auch nicht sein, eine 10 Cent Glurak Pokemon Karte oder 2 Dübel von Kiel nach Rosenheim zu transportieren. Weiter im Text.
Wenn also Produkte und Güter zurückgesendet werden, dann müssen die bereits aufgebauten, dabei aber sträflich vernachlässigten Prozesse und Infrastrukturen intensivst ausgebaut und mehr und mehr professionalisiert werden. Im Grunde müssen die Rebuyer und Medimopser dieser Welt ihre Geschäftsmodelle und Erfahrungen ausrollen auf viele andere Industrien (Hey ihr zwei, neue Geschäftsfelder incoming: Prozessberatung! Dankt mir später).
Da die Logistik der Motor der Circular Economy ist [2], verändern oder erweitern sich also ihre Geschäftsfelder - und neue können erschlossen werden. Es entstehen neue logistiknahe Opportunitäten neben dem reinen Transport. So wird die Frage geklärt werden müssen, ob zurückgeführte Waren individuell zerlegt, aufbereitet oder repariert und einer weiteren Verwendung als Rohstoff, Ersatzteil oder auf den Second-Hand-Markt zugeführt werden. Je nach Antwort gehen das Produkt oder seine Komponenten an unterschiedlichen Stellen wieder in die Lieferkette ein.
Bei der Beantwortung dieser Frage entstehen also neue Geschäftsfelder. Neue Services oder CFO/CEO-konform ausgedrückt: Value Added Services! Bämmmm. Landener: 1. Semester BWL, Check. Ein Feld, welches eben durch Logistikdienstleister besetzt werden kann, denn sie stehen sowieso an zentraler Stelle und können diese neuen Aufgaben übernehmen, statt nur zu transportieren und zu lagern. [12] Solche Value Added Services sind auch margenträchtiger als das herkömmliche Geschäft.
Das betrifft letztlich auch die Kundenbeziehungen und Berührungspunkte mit diesen. Denn durch Rezirkulation entstehen ebensolche neue Märkte, beispielsweise für Ersatzteile oder Pay-per-Use-Modelle, mit denen wiederum neue Kundengruppen adressiert werden können. Logistiker können sich vom Dienstleistungsunternehmen zum wertschöpfenden Mitglied in der Lieferkette weiterentwickeln. [12]
Aber so schön das auch klingen mag. Aus eigener Erfahrung weiß ich folgendes: Unternehmen scheuen häufig den (finanziellen und organisatorischen) Aufwand vor dem Hintergrund der schwer abschätzbaren Chancen und Risiken, die ein neues Geschäftsmodell weg vom Verkauf von Neuprodukten hin zu beispielsweise servicebasierten Modellen mit sich bringt. [13]
Reverse Logistics: Urban Mining (Sekundärrohstoffe)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der zu erwartenden Rohstoffverknappungen die Beschaffung von Sekundärrohstoffen, formerly know as „Abfall“ (u.a. durch Urban Mining) einen Boost erfahren wird.
Häh: Urban Was? Urban Mining! Ziel hierbei ist aus langlebigen Gütern sowie Ablagerungen Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Anders als der Name es vermuten lässt, befasst sich Urban Mining mit dem gesamten Bestand an langlebigen Gütern und ist nicht zu betrachten als Schrottlager 2.0. Darunter fallen beispielsweise Konsumgüter wie Elektrogeräte, Autos aber auch Infrastrukturen, Gebäude und Ablagerungen auf Deponien. [14]
Am ehesten und einfachsten kann man sich das vorstellen mit den im Ruhrgebiet sehr bekannten „Klüngelskerlen“ (fahrende Schrotthändler oder auch mobile Schrottplätze genannt). Die Klüngelskerle fahren - angekündigt von einem (wieder)erkennbaren Ohrwurm-Gedudel aus dem Jamba-Sparabo [15] - quasi von Haustür zu Haustür und sammeln „Schrott“ ein.

Insofern ist Urban Mining irgendwie eine Fortführung dessen, was die Visionärsfamilie „Die Ludolfs“ einst aufgebaut haben. Es ist aber noch mehr als die Assoziation mit den Schrott-Hohenzollern aus Dernbach. Der Handlungsrahmen des Urban Minings als strategischer Ansatz des Stoffstrommanagements reicht vom Aufsuchen (Prospektion), der Erkundung (Exploration), der Erschließung und der Ausbeutung anthropogener Lagerstätten bis zur Aufbereitung der gewonnenen Sekundärrohstoffe und deren Wiedereinsatz in der Produktion. [14]
Gerade der Lückenschluss zwischen Recyclingunternehmen als Lieferanten von Sekundärprodukten, -baugruppen und -rohstoffen sowie den Unternehmen der produzierenden Industrie als Abnehmer und Reparaturdienstleister ist eine maßgebliche Herausforderung der Transformation hin zu einer Circular Economy. Und die Logistik ist hierbei ein - wenn nicht gar DER - entscheidende Faktor. [6]
Heute nennt sich das also „Urban Mining“. Und geht dabei - wie beschrieben - noch viel weiter als die Klüngelskerle oder Peter, Uwe, Manni und Horst-Günter. Denn die heutigen Urban Miner holen den Schro… , äh Sorry, die Sekundärrohstoffe dort ab, wo sie entstehen. [24] Und dass eben nicht nur von Privathaushalten. Sondern auch von Baustellen, von Industrieunternehmen, etc.
Kurze Frage für Zwischendurch: Wie viele Smartphones liegen in deiner Schublade oder in einem Karton in deinem Keller / auf deinem Dachboden? Laptops? Kameras? Generell Elektrogedöns? Schätzungen zufolge sind derzeit 7% des weltweiten Goldes in Elektroschrott eingeschlossen, und in einer Tonne Elektroschrott steckt 100-mal mehr Gold als in einer Tonne Golderz. Pro einer Million recycelter Mobiltelefone können schätzungsweise 16.000 kg Kupfer, 340 kg Silber, 34 kg Gold und 15 kg Palladium zurückgewonnen werden. [17]
Diese Produkte oder zumindest einige der darin enthaltenen Materialien haben einen hohen Restwert. Derzeit gibt es aber kaum einen Anreiz, sie zurückzugeben. [18] Und bevor wir alle nun auf DAS System oder DIE Industrie einprügeln. Ja, dahinter steckt auch eine gesellschaftliche Frage respektive Aufgabe: Denn solange wir ungenutzte Gegenstände als Lagerware für den Keller betrachten (und eben nicht als Sekundärrohstoffe mit Restwert), gibt es weder Anreiz noch einen vermeintlichen persönlichen Vorteil, Produkte zurückzugeben. [18]
„If you want a circular economy, you’ll need a circular society!“
Wer mehr wissen will, kann gerne in Podcast Folge 36 von „Das Gleiche in Grün?!“ mit Florian Kriependorf von den Schrottbienen (ScrapBees) reinhören:

Reverse Logistics: Reparatur
Wer schon mal eine Kaffeemaschine auseinandergebaut hat, der kennt die der Wegwerfgesellschaft zugrunde liegende Problematik. Billigere Kaffeemaschinen sind größtenteils nicht einfach auseinanderzubauen. Sie sind bspw. geklebt und nicht verschraubt, was deren Herstellung erheblich billiger macht. Was aber wiederum auch dazu führt, dass eine defekte Kaffeemaschine weggeschmissen werden muss, weil man zwar reparieren, aber nicht wieder zusammenbauen kann. Der niedrige Preis einer neuen Kaffeemaschine führt zusätzlich psychologisch dazu, dass man sie auch gar nicht reparieren möchte.
Beim Auto spricht man von einem „wirtschaftlichen Totalschaden“, wenn die Reparaturkosten eines Fahrzeugs höher sind als dessen Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts. Grundsätzlich ist an diesem Phänomen nichts auszusetzen. Wenn aber die Reparaturkosten immens hoch sind (weil die Tätigkeiten bei einem Reparaturvorgang sehr komplex sind), und zusätzlich der Restwert eines Produktes nach dem Neukauf rapide fällt, dann ist das schon ein Problem. Das provoziert natürlich den Konsum (Neukauf), was einerseits gut für die Wirtschaft, aber andererseits natürlich schlecht für Umwelt ist.
Auf dem Weg in eine umfassende Circular Economy ist die Kultur des Reparierens also ein wichtiger Schritt, denn letztlich führt die Reparatur dazu, dass weniger Abfälle entstehen, Ressourcen in Summe geschont werden und die Abhängigkeit von neuen Ressourcen verringert wird [20], was in der aktuellen geopolitischen Lage eh eine gute Strategie ist. Nicht zu verachten ist auch der positive Effekt auf lokale Industrien und vor allem einer Branche, der wir gesamtgesellschaftlich mehr und mehr den Rücken gekehrt haben: dem Handwerk.
Supply Chains sind heute sehr stark auf die Produktion und Distribution vergleichsweise kurzlebiger Produkte ausgerichtet (Massenproduktion), und sehen nur sehr bedingt Rückflüsse zu Reparaturzwecken vor. Dies ist ein zentrales Problem, das die EU mit dem Right-to-repair angehen möchte. Im Jahr 2024 haben sich die EU-Gesetzgeber auf neue Reparaturvorschriften geeinigt. Die neuen Vorschriften stellen sicher, dass Hersteller zeitnahe und kostengünstige Reparaturen anbieten und Verbraucher über ihre Reparaturrechte informieren.
Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung ist der Hersteller weiterhin verpflichtet, gängige Haushaltsprodukte, die nach EU-Recht technisch reparierbar sind, wie Waschmaschinen, Staubsauger und sogar Smartphones, zu reparieren. Die Liste der Produktkategorien soll im Laufe der Zeit erweitert werden. [21] Überdies sind Softwarepraktiken verboten, die eine unabhängige Reparatur und die Verwendung kompatibler und wiederverwendeter Ersatzteile verhindern.
Daraus folgt für die Logistik, dass einerseits ein nicht zu verachtender Teil von Konsumprodukten zu den Reparateuren transportiert werden muss und andererseits ein Anstieg bei der Ersatzteillogistik zu erwarten ist. Da natürlich auch aufgrund dessen mit mehr Verpackungsmaterial zu rechnen ist, muss hier dementsprechend ebenfalls gegengesteuert werden. Stichwort: PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), die u.a. darauf abzielt, dass Mehrwegversandsysteme genutzt werden, um Einwegkartonagen und -verpackungen zu minimieren.
Reverse Logistics: Sharing Economy
Eine Sonderstellung bei der Reverse Logistics nimmt das Thema Sharing Economy ein. Die Schnittmengen zwischen Sharing und Circular Economy sind fließend. Modelle zur Maximierung der Auslastung und Verlängerung der Produktnutzung durch kollaborative Ansätze, wie es die Sharing Economy bietet, werden allenthalben der Einfachheit halber ebenfalls zur Circular Economy gezählt.
Aber was ist das genau? Die Sharing Economy bezeichnet ein Wirtschaftsmodell, bei dem Ressourcen wie Güter und Dienstleistungen gemeinschaftlich genutzt, geteilt, getauscht, gemietet oder verliehen werden. Berühmte Beispiele sind das Ausleihen von Werkzeugen, das Teilen von Wohnraum über Airbnb, Mitfahrgelegenheiten mit Uber oder das Mieten von Autos bei Carsharing-Anbietern.
Info: Ein Verbraucher im privaten Sektor nutzt bspw. eine Bohrmaschine vom Kauf bis zur Entsorgung durchschnittlich 10 bis 13 Minuten in Summe. Die grundsätzliche (Bedarfs-) Frage hinter der Sharing Economy bezogen auf die Bohrmaschine: Warum sollte ich mir eine kaufen, wenn sie die meiste Zeit im Keller verstaubt?
Die Sharing Economy hat logischerweise große Auswirkungen auf die Logistik. Denn besagte Bohrmaschine muss nach der Nutzung irgendwohin. Zurück zum Besitzer oder zum nächsten Nutzer. Kollaborative Geschäftsmodelle zur gemeinschaftlichen Nutzung von Produkten machen also eine aufwändigere, kleinteiligere Logistik zum Transport zwischen den einzelnen Nutzern notwendig. [6]
Du möchtest mehr darüber erfahren? Mit Anne Voigt von Miniloop haben wir in Folge 30 von „Das Gleiche in Grün?!“ über Mietmodelle für Baby-Klamotten gesprochen:

Auf der Suche nach einer passenden Lösung für deine Logistik? Hier geht’s zur Vergleichsplattform, die dir die Suche erleichtert.
Hast du einen Fehler entdeckt? Dann schreibe mir gerne! Ich bin jederzeit dazu bereit einen Fehler zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass ich etwas korrigiert habe. Ich bin kein ausgebildeter Journalist. Meine Recherchen können nicht so professionell sein wie bei einem Artikel. Neben dem Schreiben eines Blogposts, arbeite ich 40 Stunden regulär bei meinem Arbeitgeber. Ich bitte dies zu berücksichtigen.
Quellen
- [1] Timo Landener “Nachhaltigkeit und Logistik - Die Circular Economy” (2025)
- [2] Timo Landener „Nachhaltigkeit und Logistik - Die Logistik als Motor der Circular Economy?!“ (2025)
- [3] natureandmore.com
- [4] gesetze-bayern.de
- [5] verfassungen.eu
- [6] Timo Landener „Nachhaltigkeit und Logistik - Der Wert der Logistik“ (2024)
- [7] Annette Kehnel “Wir konnten auch anders” (2021)
- [8] Die Sneakerjagd
- [9] Die Sneakerjagd (Link zum Video Teil 1 und Link zum Video Teil 2 | 2022)
- [10] Das Gleiche in Grün #33
- [11] Timo Landener „Technologieoffenheit und ihre Grenzen“ (2025)
- [12] Ernst & Young (2022)
- [13] Fraunhofer (2018)
- [14] Umweltbundesamt (2022)
- [15] Schrotthändler Melodie (2011)
- [16] Lokalkompass (2014)
- [17] factory-magazin.de
- [18] circle-economy.com (2024)
- [19] Das Gleiche in Grün #36
- [20] BMUV (2024)
- [21] europarl.europa.eu (2024)
- [22] Das Gleiche in Grün #30
- [23] CSE (2025)
- [24] Schrottbienen (2025)